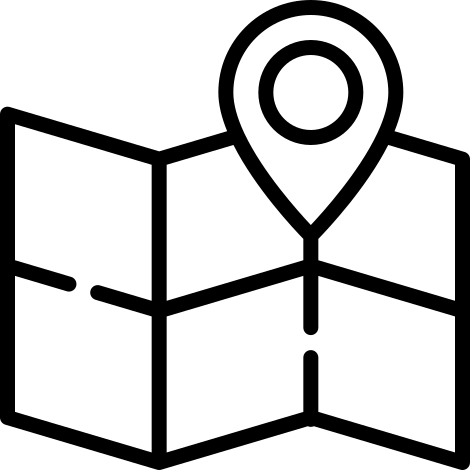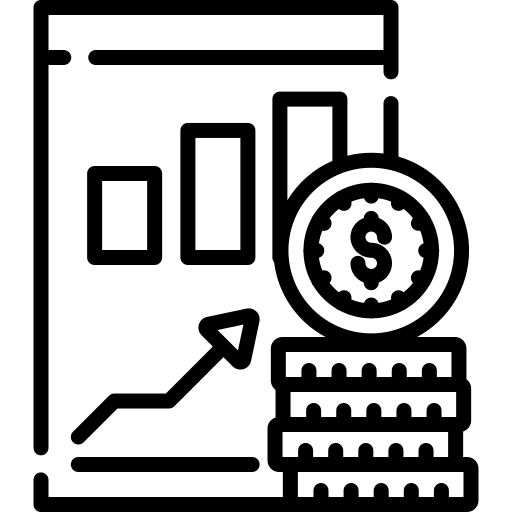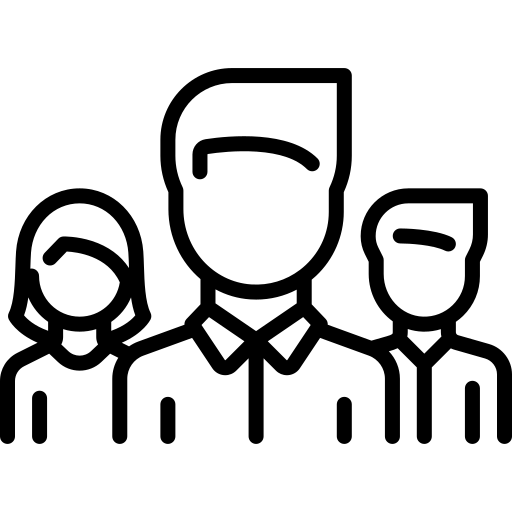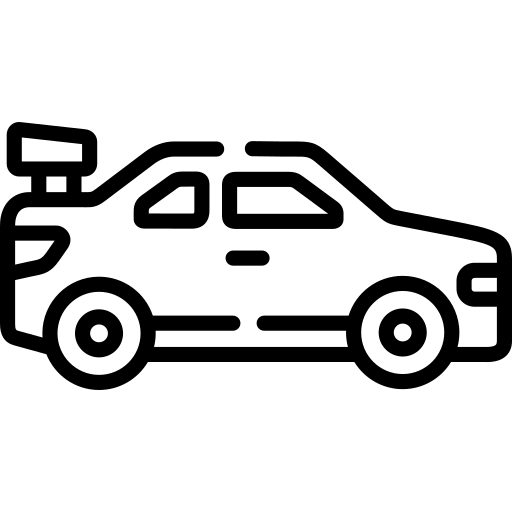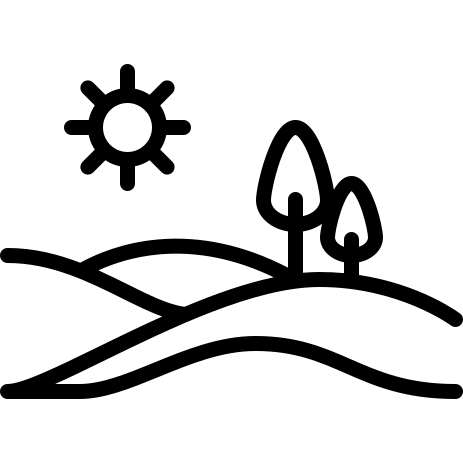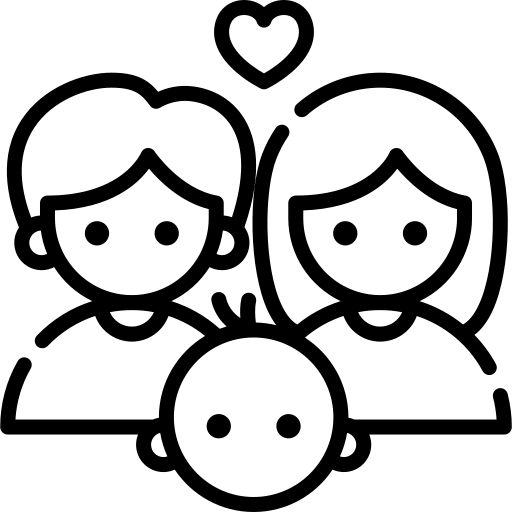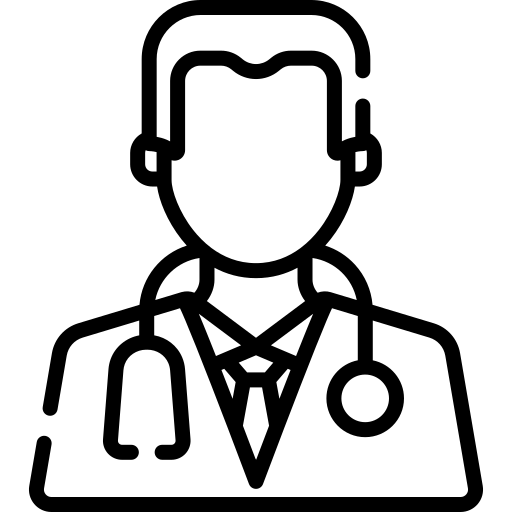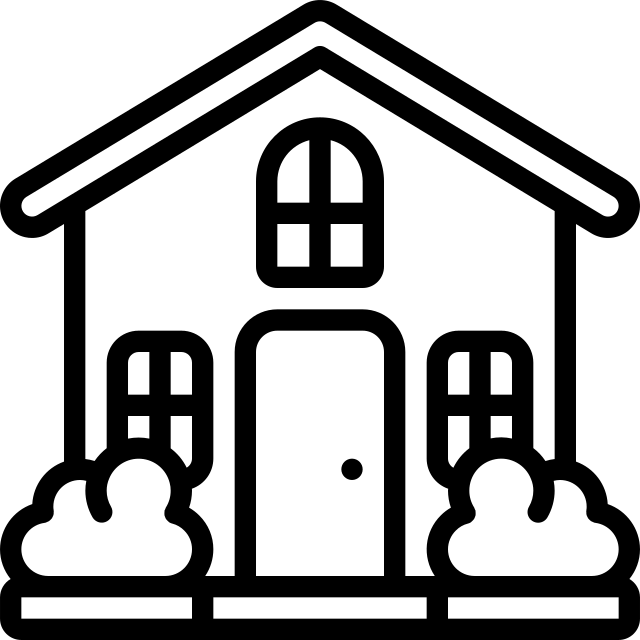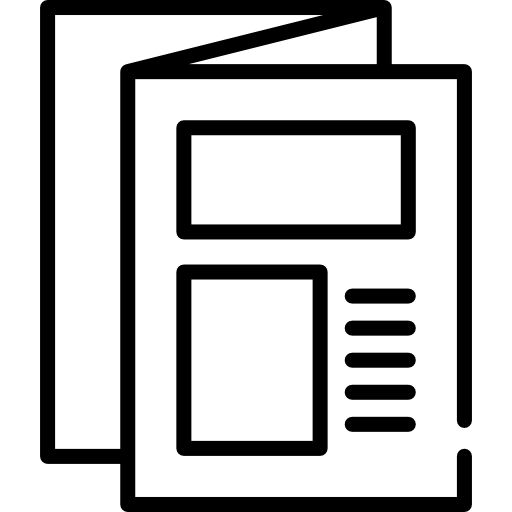Eine Kreuzfahrt ist eine gut planbare Reise, bei der man in aller Regel heute weiß, wo man morgen früh aus dem Kabinenfenster schaut. Ein Fahrplan oder gar die Route wird nicht oft geändert. Das hat erst Corona in zuvor nie vorstellbarem Ausmaß geschafft – weltweit. Schon davor aber hat es von Zeit zu Zeit so spektakuläre Gründe gegeben, dass ein Kapitän seiner Verantwortung gerecht werden und die Passagiere auf neue Küsten, andere Häfen einstimmen musste. Nicht alle Gäste mochten die jeweiligen Notwendigkeiten sofort einsehen. Kapitäne mit Charisma und großer Erfahrung fangen in solchen Fällen die Wichtigtuer schnell ein. Und am Ende des Tages räumte schon so mancher Lautsprecher ein, dass die Entscheidung zum Kurswechsel nicht nur geboten war, sondern dass letztlich der neue Ort Attraktionen parat hatte, mit denen man nie gerechnet hatte.

Busuanga statt Bali
Es liegt ein paar Jahre zurück: Bali sollte Höhe- und Schlusspunkt einer faszinierenden Reise durch fernöstliche Gewässer sein. Das Wetter war gut, manche Passagiere lagen an Deck, andere hatte sich aus der Bibliothek Literatur zur Insel der Götter besorgt, ein Großteil der Gäste wollten dort unter der Kokospalme die Reise durchs Südchinesische Meer in Ruhe Revue passieren lassen.
Und dann, von jetzt auf gleich, sprach sich eine Nachricht aus der Zentrale in Hamburg herum: Bali könne aus Sicherheitsgründen nicht angelaufen werden, es habe dort einen schlimmen Anschlag gegeben. Im Paradies war plötzlich die Hölle los. Man müsse auf die Philippinen ausweichen, auf die Insel Busuanga im Calamian-Archipel.
Busuanga? Dazu gab es keine Literatur an Bord. Der Lektor packte seine Bali-Bilder ein – und hatte eine Idee: Es gab viele Filipinos an Bord, die könnten doch etwas über ihre Heimat erzählen. Ein Steward aus der Region Palawan, zu der Busuanga gehört, war tatsächlich schnell gefunden. Noch am selben Abend erzählte Manuel, übersetzt vom Lektor, aus seinem Dorf, von der Bedeutung des Hahnenkampfes, vom Kirchgang der frommen Katholiken, und dass eine seiner drei Töchter inzwischen die Universität in Manila besuche. Das sei nur mit dem Geld möglich gewesen, dass er jeden Monat nach Hause schicke. Manuel bekam viel Beifall, einige Zuhörerinnen hatten Tränen in den Augen.
Begeisterung auch auf Busuanga. Nie zuvor hatte hier ein Kreuzfahrtschiff festgemacht. Also gab es keine Busse, schon gar keine klimatisierten. Und was passierte? Die anspruchsvollen Gäste, die schon überall waren, sie setzten sich ohne Umstände auf die Ladefläche der landestypischen Großraum-Taxis, Jeepneys genannt, und vertrauten fröhlich auf die frommen Wünsche an der Heckklappe („Maria, help us“). Der Weg ging an der Küste entlang, vorbei an Fischern, die unter Kasuarinen hockten und ihre Netze flickten. Mit viel Juchu rollten die Jeepney-Passagiere schließlich hinein ins pralle Leben, zum Dorffest mit Schwein am Grill.
Der Traum nach dem Schock
Unterwegs in Westindien, mit einem sehr kleines, sehr gemütlichen Schiff. Einige Passagiere freuten sich auf Martinique, andere auf Trinidad, Synonym für Lebensfreude und karibischen Karneval. Und auch hier wieder eine Durchsage von der Brücke, ganz plötzlich: Nichts geht auf Trinidad, die Kinderlähmung war dort ausgebrochen, ein Schock auch an Bord.
Konnte man einfach so weiter schippern, die nächsten Häfen unbeschwert anlaufen? St. Vincent hieß das Ausweich-Inselchen, auch damals schon kein ganz weißer Fleck mehr auf der karibischen Karte, aber weit weniger bekannt als Trinidad. Am Anleger im Hauptstädtchen Kingstown wartete eine Steelband, „Angelina“ dröhnte über den Kai. Dort stand auch Joseph, der Taxifahrer. Sieben Kinder hatte er, die er uns im mitgeführten Fotoalbum vorstellte. Er kannte die schönsten Strände und erzählte uns die Geschichte des Brotfruchtbaumes, die mit der Meuterei auf der Bounty zusammenhing. St. Vincent war letztlich auch für jene, die nicht mit Joseph unterwegs waren, ein Ersatz, der zum Höhepunkt werden sollte.
Die Meuterei vor Taiwan
Taiwan, das andere China, sollte umrundet, Taipeh, die Hauptstadt, Höhepunkt dieser Seereise durch die ostasiatischen Gewässer werden. Dann kamen die Taifun-Warnungen, von Stunde zu Stunde besorgter. Taipeh, so war bald klar, würde besonders betroffen sein. Also Kursänderng. Kaoshiung im Süden Insel sollte die Lösung werden. Was glaubte man von der Hafenstadt zu wissen: Industrie, Hochhäuser, nun ja, eine Millionenstadt...
Es gab Passagiere, die lautstark reklamierten. Sie hätten doch die Reise nur gebucht, um Taipeh und dort das Nationalmuseum sehen zu können. Man habe im übrigen schon ganz andere Stürme abgeritten. Der Protest der sehr kleinen, sehr lauten Querulantentruppe wurde heftiger. Bis der Kapitän, ein ruhiger Seebär der alten Schule, ein Machtwort sprach: Ein Taifun sei etwas anderes als ein Sturm, er und kein anderer trage hier die Verantwortung, Ende der Diskussion. Die Handvoll „Meuterer“zog kleinlaut ab, entschuldigte sich am nächsten Morgen mit rotem Kopf.
Und Kaohsiung? Überraschung: Tempel voller Geheimnisse, authentisches Leben, Nachtmärkte ohne Gedrängel, Ausflüge in Nationalparks voller kleiner Wunder. Und Sonnenschein bei leichter Brise, 180 Seemeilen entfernt von Taipeh, wo der Orkan genau an dem Tag wütete, als wir dort hätten sein sollen... BERND SCHILLER