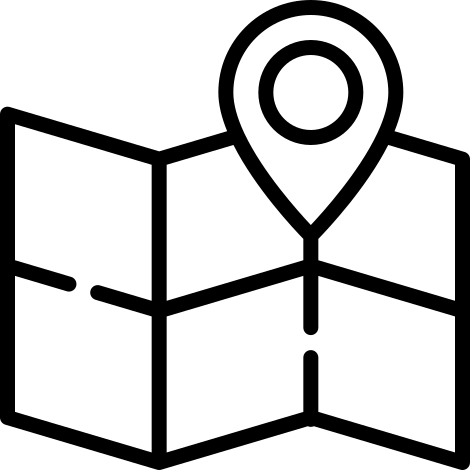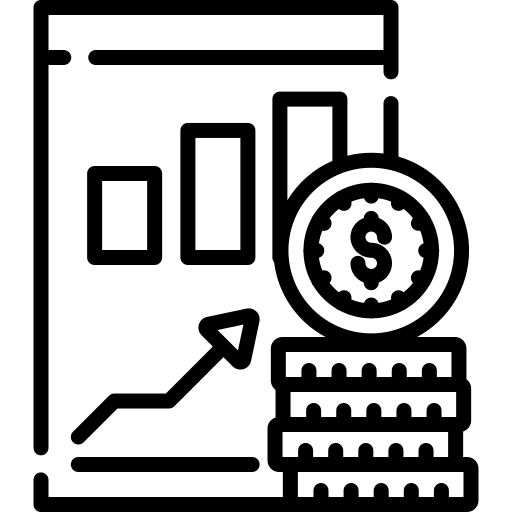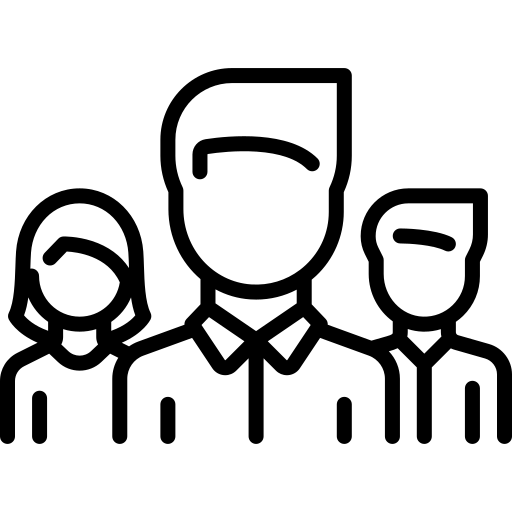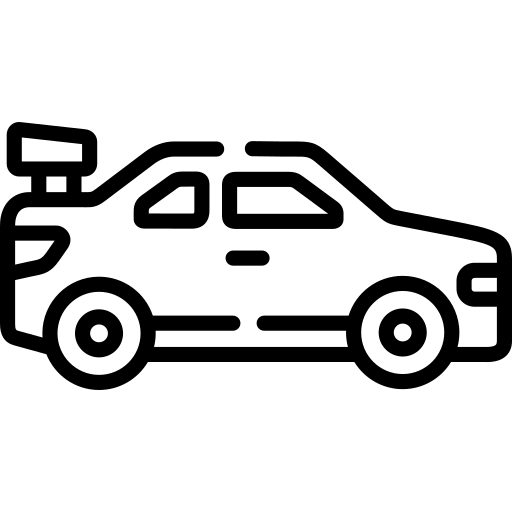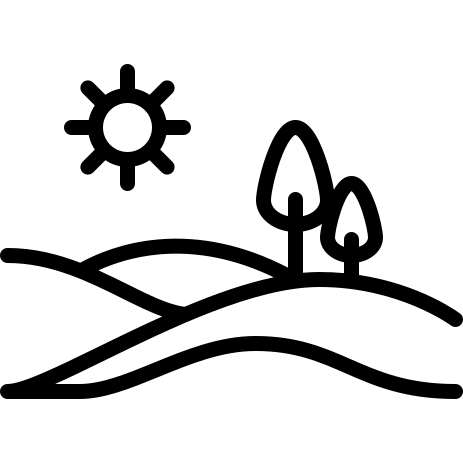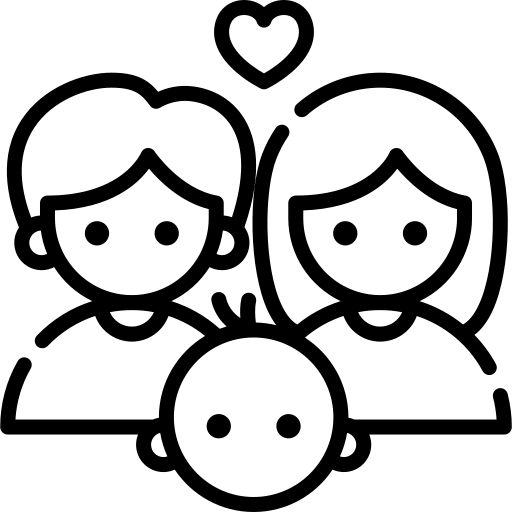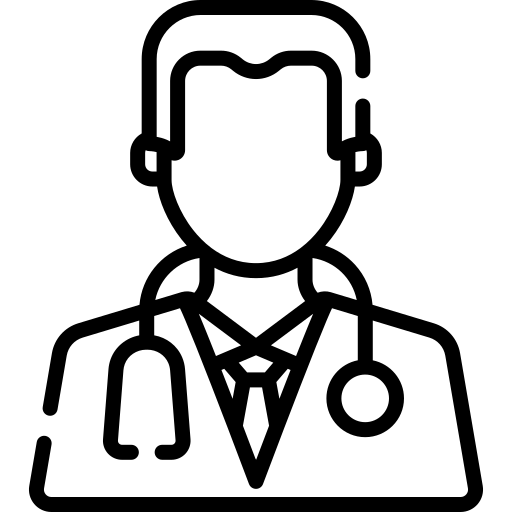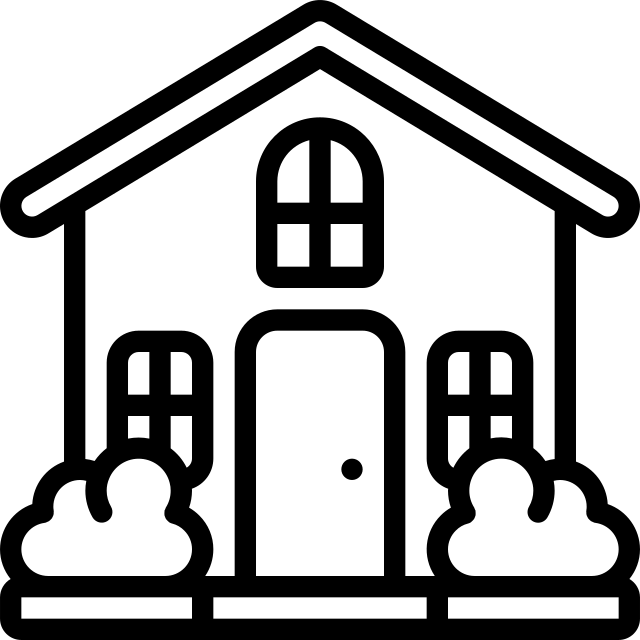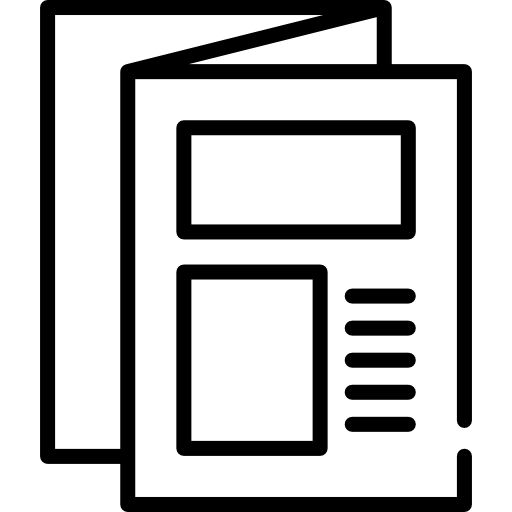Haben Tiere Angst vor dem Tod? Paraskevi Mavrogiorgou würde das nicht ausschließen. Sie könnten durchaus eine intuitive Furcht vor dem Ende haben, meint die Psychiaterin. Ihr Ehemann Georg Juckel, ebenfalls Psychiater, ergänzt: „Schließlich haben Tiere ja auch eine Art siebten Sinn für Katastrophen.“
Fest steht, dass der Mensch die Angst vor dem Tod kennt - vielleicht, weil er so unvorstellbar ist, dass sich über die Jahrhunderte verschiedenste Bilder entwickelt haben. Der Tod als Sensenmann, ein Leben nach dem Tod, der Tod als Erlösung von Schmerz oder Krankheit - all diesen Vorstellungen begegnet das Psychiater-Ehepaar regelmäßig. Eine breite Palette von Erfahrungen, Zugängen und Erkenntnissen beschreiben beide in ihrem Buch „Zeit - Endlichkeit - Liebe“.
Der Mensch sei davon überzeugt, dass sein Bewusstsein „ewig vor sich hinleben“ werde, sagt Juckel - und nicht davon, dass das Selbst einen Anfang und ein Ende habe.„Wir können uns nicht vorstellen, wie es ohne Bewusstsein ist. Es fühlt sich bedrohlich an zu wissen, dass unser Ich einmal nicht mehr da sein wird - mehr als dieses Ich haben wir ja nicht.“
Unterscheiden müsse man allerdings, betont Mavrogiorgou, zwischen einer normalpsychologischen Sorge - und einer sogenannten pathologischen Ausprägung. Wenn jemand sehr belastet sei und massiv unter Angst vor dem Tod leide, deute dies auf eine krankhafte Form hin. Diese„Thanatophobie“ kann auch isoliert bei Menschen bestehen, die ansonsten psychisch unauffällig seien. Generell, so die Expertin, sei die menschliche Fähigkeit zur gedanklichen Vorwegnahme des Todes jedoch nicht gut erforscht.


Beide haben Befragungen durchgeführt, um diese Lücke zu schließen. Eine Erkenntnis: Die meiste Angst herrscht vor einem Sterbeprozess, der sich hinzieht und für Leid sorgt. Schwerkranke Menschen zeigten indes seltener Angst vor dem Tod.„Das hat uns überrascht“, sagt Mavrogiorgou. Psychische Erkrankungen wiederum könnten diese Wahrnehmung beeinflussen: Wer eine schwere Depression durchlebe, dem sei der Tod vielleicht schlicht gleichgültig.
Der italienische Psychoanalytiker Franco de Masi verglich die Todesangst einmal mit der Angst psychotischer Menschen vor dem Verlust ihres inneren Zusammenhalts.
Zugleich beobachten die beiden Bochumer Mediziner, dass es für viele Patientinnen und Patienten ein regelrechtes Aha-Erlebnis sei, wenn man sie frage: „Wo sehen Sie in Ihrem Leben einen Sinn?“ Mavrogiorgou: „Das erwartet niemand von einem Psychiater. Dieses Verlassen der üblichen Ebene führt schon mal zu einer Irritation und öffnet eine Tür. Wenn jemand dann anfängt, über seine tiefsten Gefühle und Gedanken zu sprechen, vielleicht zum ersten Mal, gibt das vielen ein gutes Gefühl.“ Die Angst vor dem Tod sei nämlich nur ein Aspekt eines größeren Themas, sagt Juckel.
„Die nächste Frage ist, ob ich ein gutes Leben führe und was die Kräfte in meinem Leben sind, etwa Beziehungen oder auch eine religiöse Dimension.“ Vergänglichkeit und Vergeblichkeit seien„Teil der menschlichen Erfahrung“, die auch im therapeutischen Bereich nicht verdrängt werden sollten. Die spirituelle Komponente, die hier anklingt, integrieren beide bewusst in ihre Arbeit.„Dabei geht es nicht unbedingt darum, wie gläubig man ist oder wie viel Gottesbezug man im Alltag hat“, erläutert Juckel.
In der Medizin werde zu selten darüber gesprochen, „wie es mit den berühmten ,letzten Fragen' aussieht: Woher komme ich, wohin gehe ich, was ist sinnerfülltes Leben?“
Kritisch sehen die Autoren zudem manche gesellschaftliche Entwicklung. „Während der Corona-Pandemie haben wir gelernt, dass die anderen sterben: die in Bergamo zum Beispiel. Und wir haben gelernt, dass der andere der Feind ist, der infiziert sein und mich anstecken könnte“, sagt Juckel. Beides verstärke egoistische Gefühle - was für den Umgang mit dem Tod wiederum fatal sei. „Wir können mit ihm umgehen, wenn wir diesen Egoismus aufgeben und das Menschheitsschicksal annehmen: Ja, wir müssen alle sterben, aber wir können zusammenstehen.“ Für dieses Grundproblem gebe es jedoch kaum ein Bewusstsein.


Angst behandle man, indem man sich ihr stelle - nicht, indem man sie vermeide, mahnt Paraskevi Mavrogiorgou. So sei es paradox, dass Verstorbene kaum noch zu Hause aufgebahrt würden, während sich doch ein Großteil der Menschen wünsche, in den eigenen vier Wänden zu sterben. Und: „Viele Angehörige bringen sich selbst um die Gnade, eine nahe Person bis zuletzt begleitet zu haben.“ Eine solche Zeit sei schmerzlich und anstrengend, aber wer sie erlebt habe, berichte häufig von einer„tiefen Dankbarkeit, einer neuen Wertschätzung für das Leben – und auch von weniger Todesangst.“
Schon in der Schule sollten diese Themen daher besprochen werden. Sei es im Religionsunterricht, sei es, wenn ein Mitschüler erkranke – oder im Zusammenhang mit Themen, die junge Menschen bewegen, etwa der Klimakrise. Auch die Kirche könnte hier viel bewegen, „wenn ihre Sprache mitmenschlicher und direkter wäre“, meint Juckel. Und Mavrogiorgou ergänzt: „Ihre Stimme fehlt, zumindest hierzulande.“
VON PAULA KONERSMANN